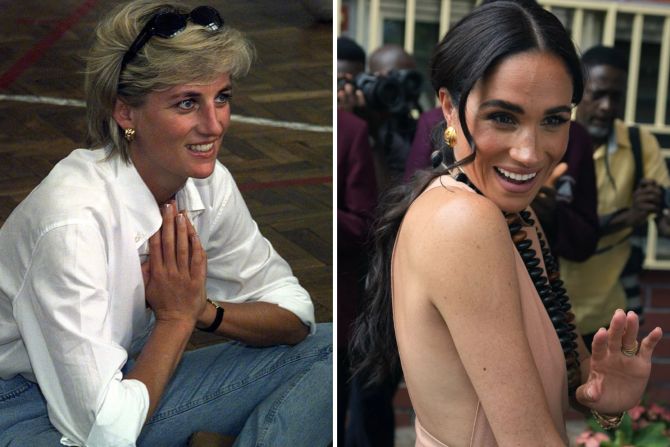Harvey Weinstein: Profitiert er von der Anti-Woke-Bewegung?
Harvey Weinstein steht erneut wegen Sexualverbrechen vor Gericht. Seine Verteidiger nutzen das Anti-Woke-Klima in den USA aus und hoffen auf einen Freispruch.

Der ehemalige Filmmogul Harvey Weinstein steht in New York erneut wegen Sexualverbrechen vor Gericht. Zuvor hatte ein höheres Gericht sein früheres Urteil aufgehoben.
Begünstigt die veränderte gesellschaftliche Stimmung – insbesondere die Kritik an «Woke»-Bewegungen – nun seine Verteidigung?
Prozess gegen Harvey Weinstein wieder aufgenommen
2020 wurde Weinstein zu 23 Jahren Haft verurteilt, doch das Urteil wurde 2024 wegen Verfahrensfehlern kassiert. Die Staatsanwaltschaft konzentriert sich laut «Zeit» nun auf drei Vorwürfe:

zwei bereits bekannte Fälle (Zwangs-Oralsex und Vergewaltigung) sowie einen neuen Vorwurf aus dem Jahr 2006. Bei diesem gibt eine Frau an, ebenfalls zum Oralsex gezwungen worden zu sein.
Die Verteidigung stellt die Vorwürfe als nachträgliche Ausnutzung der #MeToo-Bewegung dar: «Anti-Woke»-Narrative gewinnen in den USA derzeit an Zuspruch.
«Anti-Woke»-Klima in den USA
Der aktuelle Prozess fällt in eine Zeit, in der konservative Kreise die #MeToo-Bewegung zunehmend als «überzogen» kritisieren. Weinsteins Anwälte argumentieren offen, die gesellschaftliche Stimmung habe sich seit 2020 gewandelt.
Sie hoffen laut «Tagesspiegel» auf einen Freispruch im Zeichen dieser «neuen Normalität». Zwar begründete das Berufungsgericht 2024 die Urteilsaufhebung rein juristisch (unzulässige Zeugenaussagen zu nicht angeklagten Taten).
Doch die parallele Anti-Woke-Diskussion könnte die Wahrnehmung des Falls prägen. Schon im Los-Angeles-Prozess 2023 warf Weinsteins Team Klägerinnen vor, ihre Aussagen seien «vom #MeToo-Geist gefärbt».
Schon Auswahl der Jury war schwierig
Die Herausforderung, eine unvoreingenommene Jury zu finden, unterstreicht die Komplexität: Von 300 potenziellen Geschworenen blieben nach strenger Auswahl zwölf Jurymitglieder und sechs Ersatzpersonen übrig.

Wer eine zu klare Haltung zur #MeToo-Bewegung hatte, wurde nicht ausgewählt. Weinsteins Anwalt Arthur Aidala betont die Differenz zwischen «unmoralisch» und «strafrechtlich relevant» und stellt die Glaubwürdigkeit der Vorwürfe infrage:
Warum hätten die Frauen weiterhin Kontakt gesucht, wenn die Begegnungen tatsächlich traumatisch gewesen wären? Aidala nutzt dabei eine Strategie, die an anti-woke-Narrative anknüpft, um Zweifel an der Motivation der Klägerinnen zu säen.
Aidala setzt auf «victim shaming»
Aidala inszeniert Harvey Weinstein und die mutmasslichen Opfer laut «Tagesanzeiger» als Akteure in einem System mit etablierten Machtstrukturen: Weinstein als mächtiger Gatekeeper, der den Zugang zu Karrierechancen kontrollierte, die Klägerinnen als Teilnehmende, die die «Spielregeln» kannten und nutzten.
Die sogenannte «Casting Couch» sei nicht automatisch ein Tatort. Die Vorwürfe seien kein Ausdruck struktureller Gewalt.
Sie seien ein Versuch, Weinstein im Zuge der Bewegung gezielt zu instrumentalisieren, nachdem sein Einfluss schwand. Da ein Schuldspruch im US-Justizsystem einstimmig und ohne «berechtigte Zweifel» erfolgen muss, zielt Aidalas Taktik darauf ab, Jurymitglieder zu verunsichern.
Harvey Weinstein hofft auf Freispruch
Weinstein selbst wirkte während der Verhandlung gelassen, fast siegessicher. Er reagierte mit Lachen auf den Vergleich, er sähe «nicht aus wie Brad Pitt».
Er nickte bei Vorwürfen wie Ehebruch oder der Darstellung, die #MeToo-Bewegung diene nun dazu, ihn zu stigmatisieren. Dieses Verhalten spiegelt die Überzeugung wider, dass die hohen Beweisanforderungen einen einstimmigen Schuldspruch unwahrscheinlich machen könnte.